Aktuelles
Kalenderblatt: Karl Friedrich August Gützlaff
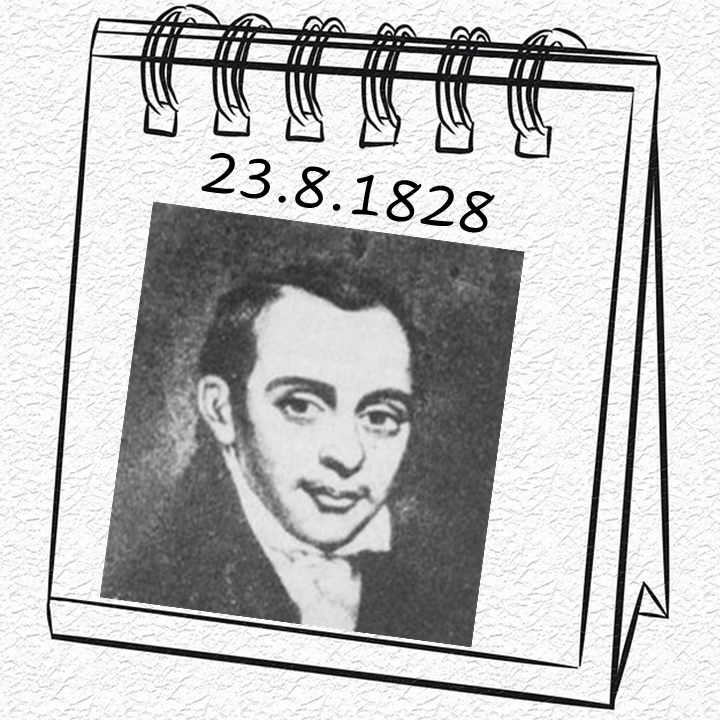
Am 23.August 1928 kam Karl Friedrich August Gützlaff in Bangkok an. Neben seinen großen Verdiensten um verschiedene Bibelübersetzungen, seine geschichtswissenschaftliche Arbeit (er verfasse eine fast 1000-seitige Geschichte Chinas, die sein Freund, der Sinologe Karl Friedrich Neumann herausbrachte, mit der er in Deutschland „bleibendes Interesse für China“ wecken wollte (Schnurr, Weltreiche, 66)) und die Gründung der Chinese Union (1844, 福漢會, CU), einer frühe chinesische protestantische Missionsgesellschaft, die bis heute als Same für die chinesische indigene Christenheit gilt (Ma, Gützlaff), möchte ich seiner als tragisches Beispiel für die unselige Verquickung von Mission und Kolonialismus gedenken.
Gützlaff reiste auf der Lord Armherst, einem Schiff der englischen Ostindischen Kompanie nach China (Siebold Geschichte, 47). Im ersten Opiumkrieg (1839-1942) unterstützte Gützlaff mit seinen landeskundlichen Erkenntnissen aktiv die britische Armee gegen die Chinesen (Maier Bekehrung, 319). Er war bereits schon 1935 in den Dienst der britischen Regierung getreten und diente für 800 Pfund Sterling im Jahr als Dolmetscher für englische Opiumhändler. Er empfand es nicht als Widerspruch, diese Tätigkeit „mit der kostenlosen Verteilung von Bibeln und christliche Traktaten zu verbinden.“ Sein Ziel war eine Million Traktate pro Jahr. 1843 wurde er Sekretär der neugebildeten Kolonialregierung von Honkong (Gründer, Mission und Gewalt, 140). Mission war sein oberstes Ziel, denn es gibt Anzeichen dafür, dass er sich sowohl dem chinesischen Verbot des Christentums wie auch der Anweisung de britischen Foreign Office, während des Krieges die Missionstätigkeit ruhen zu lassen, widersetzte (Mader, China,122). Heute gilt Gützlaff in der Volksrepublik China er „als ein Musterbeispiel für die Verstrickung westlicher Mission in den Kolonialismus“ (Mwombeki, Unterscheiden).
So abwegig uns heute die Verstrickung der Mission in den Kolonialismus zu recht scheint, so christlich verstanden die Missionare es damals zu rechtfertigen. „War nicht offenkund, das Gott sich dieses Weltreiches [das Chinas] bediente zur Verwirklichung seiner geistlichen Pläne? Nutzte nicht der Allmächtige England als Türöffner nach China für den Einzug seines Evangeliums? Wer aber ist der Mensch, dass er sich den Ratschlüssen Gottes widersetzte? War nicht die Förderung des Fortkommens des Britisch Empire geradezu Forderung? Und schließlich, wenn es dem liebenden Schöpfer, der alles zum Guten wenden kann, nicht missfiel, zu diesem Zweck selbst den Opiumhandel, in den England durch die East India Company verwickelt war, zuzulassen, konnten dann nicht auch die von ihm bestellten Diener getrost sein, dass die freizügige Wahl ihrer Mittel ebensolche Sanktifikation durch Gott erfahren würden? Für die meisten von ihnen konnte daran mit Nuancen und unterschiedlicher Gewichtung kein Zweifel bestehen“ (Mader, China, 3).
Mader urteilt, dass Gützlaff und viele andere Imperialisten sich zur Überwindung des Zweispalts zwischen religiöser Überzeugung und (welt-)politisch bedeutsamer Betätigung auf die „Providenz-Theorie“ stützte, „nach der die imperialistische Ausdehnung Großbritanniens zu Gottes mit Allwissenheit und Allmacht gehegten Heilsplans für die Menschheit gehörte“ (Mader, China, 120).
Gützlaffs schlechte Gesundheit und die Auflösung der Chinese Union führten 1951 zu seinem dramatischen Tod. „Sein Ansehen litt durch die als solche wahrgenommenen Fehler in der Führung der CU“ (Ma, Gützlaff, 1). Nach dem Tod von Gützlaff wurden viele chinesische Mitarbeiter wegen Drogenabhängigkeit aus der CU ausgeschlossen (Mader, China, 138).
Die erste Warnung des Ökumenischen Rates für Praktisches Christentum bei seiner zweiten Konferenz 1937 zu den Entwicklungen des fortschreitenden Säkularismus kommt in den Sinn: „Da wächst keine neue Hoffnung, wo man die Nation oder den Staat oder die Klasse heiligspricht“ (Egelkraut in Bockmühl, Entscheidungsfragen, 212-215).
Quellen:
Bockmühl, Klaus: Was heißt heute Mission: Entscheidungsfragen der neueren Missionstheologie (Hg. Helmuth Egelkraut), 2000.
Gründer, Horst: Mission und Gewalt im Kolonialen Kontext: Das Beispiel China, in Kolonialismus (Hg. Mihran Dabag), 136-149, 2004.
Ma, Chao: Gützlaff and the Chinese Union: A Germ for the Indigenous Chinese Protestant Church?, 2019; https://www.academia.edu/40298032/G%C3%BCtzlaff_and_the_Chinese_Union.
Mader, Friedrich; China, Opium und die Verlorenen: Aus der Sicht der protestantischen Missionspioniere, 2025.
Maier, Bernhard: Die Bekehrung der Welt: Eine Geschichte der christlichen Mission in der Neuzeit, 2021.
Mwombeki, Fidon: „Wir können zwischen Missionar*innen und Kolonialist*innen unterscheiden!“, in: Mission – geht’s noch?: Warum wir postkoloniale Perspektiven brauchen (Hg. Claudia Währisch-Oblau), 2024.
Schnurr, Jan Carsten: Weltreiche und Wahrheitszeugen: Geschichtsbilder der protestantischen Erweckungsbewegung in Deutschland 1815-1848, 2011.
Siebold, Philipp Franz von Siebold: Geschichte der Entdeckungen im Seegebiete von Japan, 2023.
